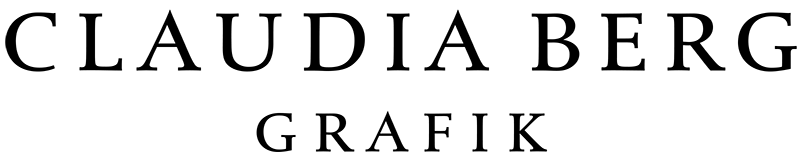Sie zeichnet eigentlich immer
Zeichnen ist eine stille und äußerst intensive Form der Auseinandersetzung mit der Welt. Jeder Mensch, der ja irgendwann und irgendwo ohne seinen eigenen Wunsch geboren wird, sieht sich in eine vorgefundene Welt versetzt, in der er sich orientieren muß, um überhaupt leben zu können oder besser noch, um eine eigene, ihm gemäße Form des Lebens zu finden. Man kann viele Sprachen lernen und alle die vielen Bücher lesen, in denen Gedanken formuliert sind, die die eigenen Nöte genauso betreffen wie die damaligen. Man kann aber auch einfach nur zeichnen. Man erkennt unser Universum, die Natur und die Kunst. Man eignet sich etwas an und zwar mit der besonderen Intensität, die im Wesen dieses Mediums liegt. Während man zeichnet, tritt man in eine vergangene Lebensform, man begegnet einer Welt mit anderen, durchaus strengeren Wertmaßstäben und mit erworbenen Kenntnissen, die uns staunen machen.
Was mir an den Zeichnungen von Claudia Berg von Anfang an gefallen hat, sind zwei Dinge. Zuerst gefällt mir die Selbstverständlichkeit des Zeichnens überhaupt, die dann zustande kommt, jemand jahrelang und eigentlich immer zeichnet, wenn das Zeichnen deshalb fester Bestandteil von Leben geworden ist und keine angestrengte besondere Tätigkeit. Dazu gefällt mir, dass sie Kunstgeschichte nicht nur aus Büchern oder nach Dias gelernt hat, sondern eben zeichnend. Sie hat sich großen Kunstwerken, oder besser gesagt Orten kultureller Verdichtung in Italien, Spanien, Frankreich und Holland, schließlich sogar China, zeichnend genähert und in der notwendigen intensiven Analyse, ohne die eine solche Tätigkeit nur ein dummes Abzeichnen wäre, Einblicke genommen in das Wesen kunsthistorischer Epochen.
Wer je zeichnend vor einem Kunstwerk gesessen hat, wird wissen, in welch erstaunlichen Maße sich die Sichtweise erweitert und bis zu einem Zustand schmerzhaften Glücks öffnet, den man durch bloße Betrachtung niemals erreichen wird. Es ist dies tatsächlich eine Form der Meditation, die zu Erkenntnissen führt und zu einer Annährung an den Schöpfungsprozeß des vorgefundenen Kunstwerkes und zu einer gewissermaßen spirituellen Freundschaft mit ihrem Schöpfer. So ist selten, dass sich Künstler einer solchen Erfahrung aussetzen. Alberto Giacometti hat, klassische Vorbilder sezierend, sie sich zu Eigen gemacht, um aber dann selbst etwas ganz anderes und neues zu schaffen. Es ist erstaunlich und gar nicht verwunderlich, dass auf unbewusste Weise diese Art Studium Bestandteil eigenen Zeichnens wird. Mir jedenfalls erklärt es im besonderen Fall von Claudia Berg die Kraft und die Tiefe ihrer eigenen Schöpfungen, die eben nicht nur auf ihrem persönlichen Talent beruhen, sondern Wurzeln haben, die in die Tiefen europäischer und asiatischer Kultur reichen, also im besten Sinne auf Traditionen gründen, ohne sie sichtbar weiterzuführen.
Was sich andeutet ist kein versöhnlicher Konsens mit der problembeladenen Welt, in die sie geraten ist. Worum es ihr offenbar geht, ist nicht die Feier des wachstumsorientierten Fortschritts, sondern die mitunter tragisch scheinende Rolle des verletzlichen und schon verletzten Individuums, das in unverschuldeter Verwirrung und Angst diesem Fortschritt ausgesetzt ist. Es gibt immer noch Menschen, die um ihr Leben kämpfen, steigend oder fallend. Wenn es Kunst schafft, diesen Prozessen noch darstellend teilzuhaben, wird sie Sinn behalten und epochenüberschreitend verständlich bleiben.
Helmut Brade